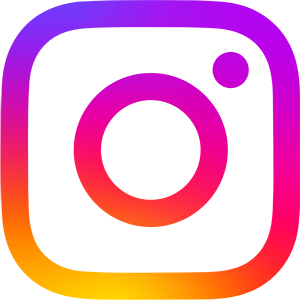Dr. Stefan Sudmann
Antike Mysterienkulte zur Zeit des frühen Christentums (aus der Sicht eines Historikers)
Wenn wir über das Thema „Gottesdienst“ sprechen, könnte es vielleicht interessant sein, dies nicht nur aus theologischer Sicht zu behandeln, sondern aus historischer Sicht auf das zu blicken, was Martin Luther in seiner Bibelübersetzung als „Götzendienst“ bezeichnet hat: die Verehrung „heidnischer“ Götter in der Antike. Dies war sowohl etwas, wovon sich über die Jahrhunderte hinweg Judentum wie Christentum abgrenzten, als auch die Form religiösen Lebens der Welt, in der die frühchristliche Mission auftrat. Davon geben auch einzelne Stellen des Neuen Testaments Zeugnis. Besonders prägnant sind dabei wohl zwei Stellen in der Apostelgeschichte: zum einen in Kapitel 19 der Protest des Silberschmieds Demetrios und anderer Handwerker in Ephesus gegen die christliche Mission des Apostels Paulus, die in Sorge um ihre Geschäfte (Anfertigung von Souvenirs für Besucher des Artemis-Tempels) mit dem Schlachtruf „Groß ist die Artemis der Epheser“ einen Massenaufruhr verursachten; zum anderen in Kapitel 17 der Besuch des Apostels Paulus in Athen, wo ihn die vielen Götterstatuen zornig machten.
Staatliche Polis-Religion in Athen
Athen ist auch die Stadt, über deren religiöse Zeremonien uns durch zahlreiche literarische Zeugnisse die meisten Informationen zu staatlichen Kulten vorliegen. Götterverehrung war keine rein private Angelegenheit. Vielmehr war sie gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Polis, der Stadt, der man sich nicht entziehen konnte und durfte. Das wichtigste Fest war die Feier der „Panathenäen“ zu Ehren der Stadtgöttin Athene, die in verschiedenen Werken erwähnt werden und sich bis zur Etablierung des Christentums im 3. Jahrhundert hielten. Verbunden waren diese mit einem kultischen Festumzug, bei dem auch die in der Stadt lebenden Fremden beteiligt waren – und die Frauen: Sie webten jedes Jahr ein neues Obergewand für Athene.
Die eleusinischen Mysterien und der christenfeindliche Kaiser
In Athen gab es aber noch mehr: Neben den Staatskulten spielten auch andere religiöse Zeremonien eine Rolle, bei denen nur Eingeweihte nach einem speziellen Initiationsritus zugelassen waren. Zu diesen gehörten als wohl bekannteste die Mysterien von Eleusis, benannt nach dem Heiligtum der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter in Eleusis bei Athen. Zwar bestanden für die Eingeweihten strenge Geheimhaltungsvorschriften, doch lassen sich durch verschiedene Zeugnisse die Grundelemente dieses Kults rekonstruieren, wozu unter anderem die Erwartung eines besonderen Lebens nach dem Tod gehörte.
Auch wenn es sich hier um einen nicht-staatlichen Geheimkult handelte, konnte er doch von politischer Brisanz sein: Kurz vor Beginn einer großen militärischen Expedition Athens gegen Sizilien im Jahre 415 v. Chr. (im Peloponnesischen Krieg gegen Sparta) kam es zum so genannten „Hermenfrevel“, bei dem nachts Stelen mit dem Kultbild des Gottes Hermes demoliert wurden. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass wohlhabende Athener in ihren Privathäusern Parodien der Mysterien von Eleusis aufgeführt hatten – darunter Alkibiades, herausragender Politiker und Feldherr, einerseits beliebt, andererseits aber auch berüchtigt für seinen übermäßigen Luxus und seine Arroganz. Er wurde aus der Militärexpedition in Sizilien zurückbeordert, floh aber und wurde dann in Abwesenheit zum Tode verurteilt und verflucht, woraufhin er zu Sparta überlief.
Noch zur Zeit Jesu und des frühen Christentums waren die Eleusinischen Mysterien von politischer Bedeutung: Kaiser Augustus ließ sich in den Geheimkult einweihen, ebenso mehrere seiner Nachfolger. Als letzter: ein Neffe des ersten christlichen Kaisers Konstantin, Kaiser Julian, später vom Christentum abgefallen (und deshalb mit dem Beinamen Apostata versehen) und für seine christenfeindlichen Maßnahmen bekannt. Neben diesen staatlichen Maßnahmen spielte die Initiation in die Eleusinischen Mysterien für ihn persönlich sicher auch eine zentrale Rolle in seiner privaten Abwendung vom Christentum. Mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion unter Kaiser Theodosius endete auch der Mysterienkult von Eleusis.
Der Dionysoskult und die Apostelgeschichte
Für einen anderen Mysterienkult wurde schon lange ein Einfluss auf das Neue Testament postuliert: In der Tradition von Wilhelm Nestle 1900 und Friedrich Smend 1925 (und anderen) analysierte der evangelische Theologe Jan Schäfer in der Theologischen Zeitschrift 2010 die intertextuellen Bezüge der Tragödie Die Bakchen zur Apostelgeschichte. Bei den Bakchen handelt es sich um eine Tragödie von Euripides aus dem Jahre 405 v. Chr., eine wichtige literarische Quelle aus Athen für die Riten des historischen Dionysoskultes, der an mehreren Orten der griechischen Welt in unterschiedlichen Formen gepflegt wurde. Diese Verbindung erscheint weniger seltsam, als es zuerst klingen mag: Der Verfasser der Apostelgeschichte – seiner Aussage nach und auch nach Auffassung der meisten Historiker identisch mit dem Verfasser des Lukasevangeliums – präsentiert sich in beiden Prooimien selbst wie ein antiker Historiker in literarischer Tradition. Die in der Apostelgeschichte auftauchenden textlichen Anspielungen auf die „Befreiungs- und Berufungsgeschichten“ der Bakchen-Tragödie zu den Dionysosmysterien sollten dieser Auffassung nach den Glauben an Jesus Christus in der von den Vorstellungen dieses Mysterienkults geprägten Welt darstellen. Dies wird verständlich, wenn man die Tragödie als Teil des „Bildungsguts“ der damaligen Welt zur Zeit des frühen Christentums sieht.
Kybele und Attis, Isis und Osiris, Mithras-Kult
Für andere Mysterienkulte der Antike wurde ebenfalls ein Einfluss auf das frühe Christentum postuliert, allerdings herrscht darüber in der Forschung keine einheitliche Meinung. So wurde bisweilen vermutet, die Magna Mater (Große Mutter) aus dem noch nach Etablierung des Christentums bis ins 5. Jahrhundert gepflegten Kult um Kybele und Attis führe in direkter Linie zur Verehrung Mariens als „Gottesmutter“ (oder eher „Gottesgebärerin“), wie sie im Konzil von Ephesus 431 definiert wurde.
Ähnliches wird für den ursprünglich aus Ägypten stammenden Kult um Isis und Osiris angenommen, der noch länger die Christianisierung des Römischen Reichs überstand: Gemeinsam sind die Vorstellungen von Tod und Auferstehung sowie die Erwartung auf Belohnung im Leben nach Tod durch Teilnahme am Kult. Sogar für Taufe und Abendmahl wollten manche Forscher Ähnlichkeiten erkennen. Diese kultischen Ähnlichkeiten wurden von Gegnern des Christentums als Beleg dafür gesehen, dass Christus nur eine auf älteren Mysterienkulten beruhende Erfindung sei – während andere Forscher hingegen verdeutlichten, dass es sich trotz gewisser Ähnlichkeiten doch um ganz unterschiedliche religiöse Vorstellungen handelte. Allgemein einig ist man sich aber, dass die Darstellung der Göttin Isis mit dem Horus-Knaben als ikonografisches Vorbild diente für die künstlerische Darstellung Maria lactans (Maria stillt Jesus).
Das gilt auch für den Mithras-Kult: Für diesen wurden einige frappierende Gemeinsamkeiten mit dem Christentum (z. B. Tod und Auferstehung) und christlichen Gottesdiensten (z. B. Abendmahl und Taufzeremonie) herausgestellt. Bei kritischer Sicht bleibt aber wohl nur der Termin des Weihnachtsfests zum „Tag des unbesiegten Sonnengottes“ als indirekter Einfluss des MithrasKultes auf das Christentum übrig.
Mysterienkulte im Umfeld der ersten christlichen Gemeinden
Wie man die Ähnlichkeiten und möglichen Beeinflussungen auch interpretieren mag: Zum Verständnis der Welt, in der die Ausbreitung des Christentums erfolgte, kann neben einem Blick auf das jüdische Leben zur Zeit Jesu auch ein Blick auf „heidnische“ Mysterienkulte im griechisch geprägten Umfeld der ersten christlichen Gemeinden von Interesse sein.