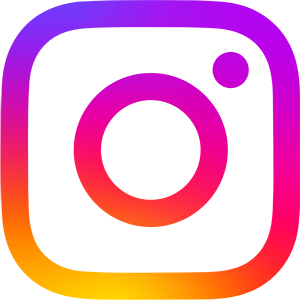Mechthild Overbeck-Neuhaus
Amici Miei – wilde Freunde
Ich warte so ungern. Warum tut sie mir das nur an? Ich trinke langsam, kleine Schlückchen, um zu verhindern, dass ich ein weiteres Glas bestelle, bevor sie eintrifft. Die Sonne schickt ihre letzten Strahlen aus der Tiefe in die noch nicht weggeräumten Weingläser am Nachbartisch. Diejenigen, die sie leergetrunken haben, sind aufgestanden und verabschieden sich lachend voneinander. Am liebsten würde ich euch folgen, meine Freunde! Amici Miei – so heißt das Lokal, auf dessen Terrasse ich sitze und warte. Ich warte auf sie in einem seltsam ungeduldigen Zustand. Ich liege auf der Lauer, spähe in alle Richtungen bis ich schließlich im Gefühl von verlorener Zeit verharre. Wie viel Zeit verbringt der Mensch im Laufe seines Lebens mit Warten? In diesen Gedanken verliere ich mich. Kann mir Zeit einfach abhandenkommen wie ein Schlüssel oder gar gestohlen werden, wie man so sagt? Ich brauche jetzt doch noch ein zweites Glas Wein.
Tagtäglich warten wir alle, auf den Zug, den Paketzusteller, aufs Wochenende, auf die Rente, den Sommer, den Richtigen oder auch nur auf den Kellner. Wir warten im Stau, vor Ampeln, im Bürgerbüro, auf den perfekten Moment oder bis die Ärztin kommt. Es gibt sogar Zimmer fürs Warten, Säle, Plätze und sogar kleine Häuser nur fürs Warten, besonders verbreitet in den Bauernschaften, wo ohnehin viel gewartet werden muss.
Mit melodiösen Warteschleifen wird Zeit geschunden und für spezielle Warteschlangen muss man zuvor eine Warteberechtigungsnummer ziehen. Genau betrachtet warten wir ständig, manchmal auch ohne genau zu wissen worauf. Warten hat nun mal mit Hoffen zu tun. Es möge bitte schneller gehen oder man erwartet, dass etwas geschieht. Im Theater kann man schon mal auf Godot warten. Das ist allerdings hoffnungslos. Ich beschließe, sie fortan Godot zu nennen. sollte sie gar nicht auftauchen.
Nun starre ich schon seit geraumer Zeit auf die Wildpferdegruppe vor der Eisdiele. Ein wenig zu lange, denn mit einem Mal verändern sich die Proportionen und die kleinen scheuen Pferde, noch immer entspannt und friedlich, beginnen zu wachsen. Eines hebt den Kopf, blickt in meine Richtung und schüttelt gelassen die Mähne. Ich zwinkere ein wenig, doch es ist zu spät. Ich kann den Blick nicht abwenden. Auch die anderen heben ihre Köpfe, lösen sich voneinander und rücken näher auf mich zu. Ein leises Schnauben ist zu hören und während sich die Gruppe langsam nähert, verändert sich der metallische Glanz des Fells, verblasst zu einem sandigen stumpfen Grau und lässt die Augen lebendig erscheinen. Stühle werden umgestoßen, ich höre Gläser klirren, die, nun zerbrochen, gerade noch Sonnenstrahlen gefangen hielten. Ich bleibe ungerührt sitzen, bis die drei Pferde wiehernd und schnaubend an meinem Tisch stehen und mich, obwohl sie eher als menschenscheu gelten, herausfordernd anblicken. Langsam erhebe ich mich, lege einem der Pferde eine Hand auf den Mähnenkamm und streichele es vorsichtig. Und in einem Sekundenbruchteil sitze ich auf dem Pferderücken und fliege galoppierend davon, immer höher und höher, begleitet von den zwei anderen Wildpferden, die während unseres Reiterflugs in geheimer Choreographie mit gleichbleibendem Abstand zueinander die Positionen wechseln. So geht es in wunderbarer Leichtigkeit hoch über den Eichengrün-Platz, in Richtung Markt und Rathaus, zurück zum Kirchturm und nach dessen Umrundung weiter zum Lüdinghauser Tor. Kurz davor, offensichtlich von ungestümer Wildheit erfasst, setzen mein Pferd und sein Gefolge zu einem Sturzflug an. Der Torbogen kommt immer näher und ich denke noch, dass wir von der richtigen Seite durch das Tor fliegen werden, da vor der gegenüberliegenden Tordurchfahrt ein Verkehrsschild deutlich macht, dass man bei Gegenverkehr zu warten hat. Warten. Bei diesem Gedanken endet der gerade noch in meinem Kopf abgelaufene Film ohne Nachspann. Und alles, was ich so überdeutlich sehen konnte, verblasst zugunsten der Terrasse, der Sonnenschirme, des Tisches, an dem ich noch immer mit halbvollem Weinglas sitze. Die Wildpferde sind an ihren Ort zurückgekehrt und bilden wieder ein metallgegossenes friedliches Sehnsuchtsbild. Alles wirkt mit einem Mal statisch und ein wenig nach links geneigt. Heftiger Wind ist aufgekommen und hat die leeren Gläser vom Nachbartisch gefegt. Regen setzt ein. Sie ist nicht gekommen, meine Godot.
Aber das Warten war keine verlorene Zeit.