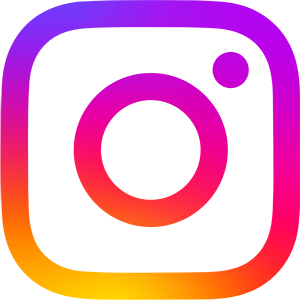Dr. Stefan Sudmann
Glück als Prüfungsthema – oder: Was ist Eudaimonie?
Glück als Thema der antiken Philosophie
Wer Philosophie oder Klassische Philologie studiert, hat bisweilen die Gelegenheit, ein Seminar zum Thema „Glück“ zu besuchen – und kann dies auch als Prüfungsthema wählen. Denn: Mehrere griechische Philosophen (und in deren Nachfolge auch ein paar römische) machten sich dazu viele und ganz unterschiedliche Gedanken, die noch auf die christliche Philosophie des Mittelalters einwirkten. Aber ebenso setzten sich noch Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche mit deren Gedanken über Glück auseinander.
Das Problem der Übersetzung
Der griechische Begriff, mit dem auch noch die Philosophen der Moderne operierten, lautet εὐδαιμονία. Wie bei allen Begriffen aus fremden – und hier dazu noch alten – Sprachen stellt sich das Problem der Übersetzung. Im wörtlichen Sinne bedeutet das aus εὖ und δαίμων zusammengesetzte Wort „einen guten Dämon (Schutzgeist) habend“. Im klassischen Griechisch wurde es als ein Wort für „glücklich“ oder „glückselig“ gebraucht. Jedoch wurde die übliche deutsche Übersetzung von εὐδαιμονία als „Glück“ (oder „Glückseligkeit“) – oder als happiness im Englischen – bisweilen als unzureichend kritisiert. Aufgrund des großen Einflusses der griechischen Philosophie wurde der Begriff Eudaimonie schließlich ein feststehendes Fachwort der deutschen Sprache für den philosophischen Glücksbegriff.
Der größte Einfluss: Aristoteles und die Nikomachische Ethik
Den größten Einfluss übte für die Nachwelt sicher Aristoteles aus. Dieser war auch in den letzten Jahrzehnten noch der ideelle Gesprächspartner für moderne Philosophen in der Debatte um die Frage des Glücks. Nicht verwunderlich: Aristoteles (384-322 v. Chr.) galt seit seiner Wiederentdeckung im 12. Jahrhundert als „der Philosoph“ schlechthin; deshalb wurde er in philosophischen Traktaten des Mittelalters bisweilen gar nicht mehr mit Namen, sondern nur noch schlicht philosophus genannt – und jeder wusste, wer gemeint war (auch noch in dem Roman Der Name der Rose von Umberto Eco: Dort klagt der blinde Mönch über den großen Einfluss der Werke „des PHILOSOPHEN, auf den mittlerweile sogar die Heiligen und die Päpste schwören“).
Vielleicht das bedeutendste Werk dieses bedeutenden Philosophen ist die Nikomachische Ethik. Hier formuliert Aristoteles bereits zu Beginn, die εὐδαιμονία sei das höchste Gut. Denn es bestünde ein deutlicher Unterschied zu anderen Werten wie z. B. Ehre: „Glück erwählen wir uns stets um seiner selbst willen und niemals zu einem darüber hinausliegenden Zweck.“ Glück sei „das Ziel all dessen, was wir tun“. Von unterschiedlichen Menschen werde Eudaimonie unterschiedlich verstanden, es gebe jedoch grundsätzliche Voraussetzungen; bedingt werde sie durch verschiedene interne wie externe Faktoren (körperlich, seelisch, materiell). Von den äußeren Faktoren sei weniger Geld als eher Freundschaft von Bedeutung; insgesamt könne man jedoch als glücklich gelten, wenn man in einer guten Gemeinschaft lebe, materiell hinreichend ausgestattet sei und tugendhaft lebe. Für das vollkommene Glück benötige es schließlich einen tugendhaften Gebrauch des Verstandes, die Erlangung von Erkenntnis und Weisheit. Aristoteles überliefert in seiner Nikomachischen Ethik übrigens auch ein altes und uns heute noch bekanntes Sprichwort aus den Fabeln Äsops, um den zeitlichen Aspekt von Glück zu verdeutlichen: Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, ein einziger Tag auch nicht; ebenso macht auch ein einziger Tag oder eine kurze Zeit niemanden gesegnet oder glücklich.
Platon und sein Lehrer Sokrates
Vor Aristoteles hatten bereits Platon und sein Lehrer Sokrates (der keine eigenen Werke hinterlassen hat, sondern nur über die Schriften seiner Schüler wie Platon oder Xenophon bekannt ist) über die Frage des Glücks reflektiert. Für Platon galt dabei sein Lehrer Sokrates als das philosophische Idealbild eines in Eudaimonie lebenden Menschen – eines Menschen, der ganz im Einklang mit seinem wahren Selbst lebt. Sokrates (399 v. Chr. hingerichtet) zeigt dabei in dem nach dem Redner Gorgias benannten Dialog gegenüber dem Sophisten Kallikles, seinem philosophischen Gegenspieler, eine klare moralische Auffassung: Die Erfüllung von Begierden durch unrechtes Handeln könne nicht glücklich machen. Wie später Aristoteles geht auch Sokrates laut Platons Symposion davon aus, dass Glück als solches erstrebt werde und nicht als Zweck, um ein etwaiges anderes höheres Gut zu erlangen. In seinen staatstheoretischen Schriften äußert Platon die Auffassung, dass Reichtum echtes Glück sogar verhindern könne: In einer durch extremen Gegensatz von arm und reich gekennzeichneten Gesellschaft sei es schwer, glücklich zu sein; ebenso müsse Reichtum einen Menschen nicht zum Glück führen.
Diogenes in der Tonne...
Noch weiter in der Geringschätzung materieller Güter als Grundlage für das Glück ging Diogenes von Sinope, Schüler des Sokrates-Schülers Antisthenes, der die philosophische Strömung der Kyniker begründet hatte. Von Diogenes selbst sind – wie von Sokrates – keine eigenen Schriften überliefert, seine Ansichten lassen sich jedoch aus anderen Quellen ungefähr rekonstruieren: Überflüssige materielle Bedürfnisse und äußere – auch gesellschaftliche – Zwänge seien hinderlich, wenn man wirklich glücklich sein wolle. Seinen anekdotischen Ausdruck fand dies in der Geschichte von der Begegnung dieses Philosophen mit Alexander dem Großen: Als der König und Kriegsherr bei seinem Besuch in Korinth, wo Diogenes lebte (angeblich in einer Tonne), den umstrittenen Philosophen, den er bewunderte, aufsuchte, ließ er diesen einen Wunsch äußern. Diogenes zeigte, dass er für sein Glück nichts mehr brauchte – er bat Alexander schlicht darum, ihm aus der Sonne zu gehen.
Stoa und Epikur als Gegensatz: Tugend oder Lust?
Im Hellenismus entwickelten sich zwei neue philosophische Schulen, die in der römischen Philosophie und Literatur nachwirkten. Ihr Erscheinen als zwei völlig gegensätzliche Denkrichtungen beeinflusste auch deren Wahrnehmung in der Renaissance. Ein besonders prägnantes Beispiel sind hierfür die Schriften des italienischen Humanisten Lorenzo Valla (bekannt vor allem als derjenige, der 1440 die sogenannte „Konstantinische Schenkung“, ein wichtiges Element im Machtanspruch des Papsttums, als Fälschung entlarvte, was Ignaz von Döllinger im 19. Jahrhundert weiter ausführte). Valla stellte – auch im Vergleich mit dem Christentum – Stoa und Epikur einander gegenüber, wobei er es jedoch im Detail mit historischen Fakten nicht ganz genau nahm. Die Stoa – zu der auch der römische Schriftsteller Seneca mit seinem Buch „Über das glückliche Leben“ (De vita beata) gehörte – sah als Inbegriff eines glücklichen Lebens den Einklang mit der Natur und dem göttlichen Logos mit einer Konzentration auf den Einsatz des Verstandes und auf ein tugendhaftes Leben, generell nicht im Gegensatz zu Platon und Aristoteles. Dabei erwiesen sie sich jedoch in der Interpretation der Tugend, deren Bedeutung für das Glück sie besonders hoch einschätzten, als deutlich radikaler und standen damit im Gegensatz zu den Schülern des Aristoteles. Denn diese waren wohl etwas realitätsnäher und beurteilten anders als die Stoiker neben einem tugendhaften Leben auch noch die äußeren Lebensumstände für das Glück als entscheidend. Epikur nahm eine davon deutlich abweichende Position ein. Diese philosophische Richtung schätzte etwas völlig anderes als zentral für das Glück ein: die Lust, griechisch ἡδονή, weshalb ihre Lehre als hedonistisch bezeichnet wurde. „Lust ist Anfang und Ende eines glückseligen Lebens“, so heißt es in seinem Brief an Menoikeus. Jedoch war damit nicht unser heutiges Verständnis von Hedonismus gemeint (das auch der Renaissance-Humanist von den Epikureern hatte), kein vorübergehendes Lustgefühl, sondern Gelassenheit und ein Leben ohne Schmerz. Dennoch übte der römische Politiker Cicero deutliche Kritik an Epikurs Gleichsetzung von Glück und Lust.
Moderne Kritik an der antiken Philosophie des Glücks
Bei allen Unterschieden darüber, was Glück sei und wie man es erreichen könne, hatten all diese antiken philosophischen Überlegungen zum Thema „Glück” doch eine Gemeinsamkeit: Sie sahen Glück ganz selbstverständlich als höchstes anzustrebendes Gut. Daran übte am Ende des 18. Jahrhunderts der deutsche Philosoph Immanuel Kant deutliche Kritik. Schon aus moralischen Gründen dürfe Glück – das in dieser idealisierten Form für Menschen gar nicht erreichbar sei – nicht als oberster philosophischer Grundsatz aufgestellt werden. Ein Jahrhundert später schrieb auch Friedrich Nietzsche (Kritiker Platons wie des Christentums, selbst klassischer Philologe und schon mit 25 Jahren Professor): Glück dürfe seiner Auffassung nach nicht als philosophisch anzustrebender Zustand angesehen werden.
Solon und Kroisos
Zum Schluss ein Blick in die Zeit vor Aristoteles, Platon und Sokrates – mit einer manchen wohl schon bekannten Geschichte, die vielleicht auch heute zum Nachdenken anregt: Solon, athenischer Politiker im 6. Jahrhundert v. Chr. und einer der „Sieben Weisen“, soll bei einer Begegnung mit dem für seinen sagenhaften Reichtum bekannten König Kroisos seine ganz eigene Sicht von Glück geäußert haben. Der König habe Solon gefragt, wen dieser für den glücklichsten Menschen halte (wobei er noch nicht den mehr philosophischen Begriff Eudaimonie gebraucht, sondern das Wort ὄλβιος). Solon habe aber wider Erwarten des Königs nicht den Namen Kroisos genannt, sondern mehrere verstorbene Männer. Auf die enttäuschte Reaktion des Königs hin erläuterte Solon, vor dem Tod eines Menschen könne man zwar das Wohlergehen eines Menschen feststellen, aber nicht beurteilen, ob dieser wirklich glücklich sei.
Alles veraltet?
Die Vorstellungen dieser antiken Philosophen konnten hier natürlich nur kurz und summarisch vorgestellt werden – aber wer dem weiter nachgehen möchten, kann sich diese Texte (auch in deutscher Übersetzung zugänglich) ja einmal etwas näher vornehmen. Denn auch für Menschen im 21. Jahrhundert könnte es vielleicht interessant sein, zum Thema „Glück“ einmal den alten Ideen „heidnischer“ Philosophen aus der Antike nachzugehen – auch dann, wenn man es nicht als Prüfungsthema hat.