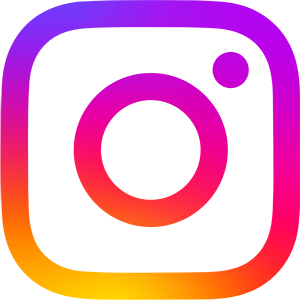Dr. Stefan Sudmann
Thomas von Aquin und der Pelikan – und andere „religiöse“ Vögel
Der Theologe, an dem man nicht vorbeikommt
Vor 750 Jahren starb Thomas von Aquin. Dies dürfte für die theologischen Kreise Anlass sein, in diesem Jahr ausgiebig über die immense Bedeutung dieses scholastischen Theologen zu reflektieren – und zwar nicht nur im Mittelalter, sondern auch für die Zeit seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als Neuthomismus und Neuscholastik die römisch-katholische Theologie und Philosophie prägten.
Ein Kirchenlied mit Vogel
Doch darum das soll es hier nicht gehen; den Theologen und Philosophen Thomas von Aquin überlässt der Historiker gern der theologischen Zunft. Vielmehr soll hier einfach nur ein kleiner kulturgeschichtlicher Blick auf ein Detail in einem Werk des Kirchenlieddichters Thomas von Aquin geworfen werden. Zur Einführung des Hochfests Fronleichnam – was selbst wieder eine theologische Behandlung anregen könnte – verfasste Thomas von Aquin 1264 den Hymnus Adoro te devote. Dieser beschreibt das Mysterium von Christi Gegenwart in der Eucharistie. Mag dieser auch nicht allen in der lateinischen Fassung bekannt sein, so doch vielen die deutsche Fassung von Schwester Petronia Steiner OP aus dem Jahre 1951: „Gottheit tief verborgen“. Meine Lieblingsstelle findet sich in der sechsten Strophe: „Gleich dem Pelikane starbst Du, Jesu mein“ (in der lateinischen Originalversion bei Thomas von Aquin: „Pie pellicane, Iesu domine“). Dass mir diese Stelle so gut gefällt, mag daran liegen, dass Vögel als die nächsten Verwandten der Dinosaurier (bzw. als direkte Nachkommen der Dinosaurier und damit aus kladistischer Sicht selbst Dinosaurier) für mich als Kind einen besonderen Reiz ausübten – weshalb meine ersten Berufswünsche auch nicht Historiker bzw. Archivar, sondern Ornithologe oder Paläontologe waren. Was aber soll der Pelikan im eucharistischen Hymnus des Thomas von Aquin? Die Antwort führt in die Welt der Symbolik: In der christlichen Ikonographie ist der Pelikan seit dem Frühmittelalter ein Symbol für Jesus Christus bzw. genauer für dessen Opfertod und die Eucharistie. Grund dafür ist die vielleicht aus dem Orient stammende und im frühchristlichen Naturlehrbuch Physiologus überlieferte Vorstellung, dass der Pelikan sich laut Legende seine Brust öffnet und mit dem daraus herausströmenden Blut seine Jungen ernährt und diese so vor dem Tod rettet – wie Jesus Christus am Kreuz bzw. in der Eucharistie. So fand der Pelikan Eingang in den eucharistischen Hymnus des Thomas von Aquin wie in die christliche Kunst zur Ausschmückung von Kirchen und liturgischen Geräten.
Andere Vögel in Bibel, Legende und kirchlicher Kunst
Der Pelikan ist jedoch nicht der einzige Vogel mit einem Bezug zu Christus und zu dessen Tod am Kreuz. Wohl mehreren Leuten bekannt ist die in verschiedenen Varianten überlieferte Legende vom Rotkehlchen bei der Kreuzigung Jesu. Eine Version hat die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf – berühmt durch Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen – in eine literarische Form gegossen.
Der Legende nach soll ein kleiner unscheinbarer Vogel von graubrauner Farbe die Kreuzigung Jesu beobachtet haben und dabei von tiefem Mitleid mit dem gequälten Mann ergriffen worden sein. So habe der Vogel beschlossen, sein Möglichstes zu tun, um mit seinen bescheidenen Fähigkeiten das Leid des Mannes am Kreuz ein klein wenig zu lindern. In einer Version der Legende zog der kleine Vogel einen Dorn aus der Dornenkrone, um den Schmerz des Gekreuzigten zumindest ein bisschen zu verringern. Einer anderen Version zufolge setzte der Vogel sich auf die Dornenkrone, um dem Gekreuzigten sozusagen zur Ablenkung vom Schmerz etwas vorzusingen. In beiden Versionen ist das Ergebnis gleich: Das Blut färbt seine Brust rot. Seitdem weisen die Nachkommen dieses barmherzigen Vogels eine rote Brust auf.
Noch ein anderer kleiner Vogel verweist auf die Kreuzigung: der Distelfink (auch Stieglitz genannt). Am bekanntesten ist sicher das 1506/07 von Raffael angefertigte Gemälde Madonna del Cardellino (Madonna mit dem Stieglitz). Auf den ersten Blick nur ein unwichtiges Detail im Bild, jedoch von hoher Symbolik: Johannes der Täufer und Jesus spielen nicht einfach miteinander unter der Aufsicht der Mutter Jesu. Johannes hält Jesus einen Stieglitz hin, der von Jesus gestreichelt wird. Mit dem Stieglitz, durch den roten Fleck auch ein Symbol für die Passion, weist Johannes der Täufer den kleinen Jesus auf dessen Leiden und Tod am Kreuz hin.
Daneben gibt es natürlich noch andere Vögel (und weitere Tiere) mit religiöser Symbolik. Man denke nur an die Taube in der Geschichte der Sintflut, an den Adler als Symbol des Evangelisten Johannes oder an das Auftreten der Gänse in den Legenden zu Martin von Tours. Gänse spielten nicht nur in dieser christlichen Legende eine Rolle, sondern auch bei den „heidnischen“ Römern: Sie galten als heilige Tiere der Göttin Juno, weshalb in deren Tempel auf dem Kapitol eine Schar Hausgänse lebte. Bei dem für Rom katastrophalen Angriff der Gallier unter Brennus im Jahre 387 v. Chr. soll nur das laute Schnattern dieser heiligen Gänse den nächtlichen Angriff auf das römische Machtzentrum verraten haben, so dass zumindest noch die dortige Festung von den Römern gehalten werden konnte.
Und zuletzt noch der Verweis auf einen Vogel, der mehrmals in der Bibel erwähnt wird: den Storch. Dieser ist dabei jedoch weniger von religiösem als von ornithologischem Interesse. Bei Jeremia wird in Kapitel 8 über die Verblendung Israels geklagt. In Vers 7 heißt es dort ganz konkret: „Selbst der Storch am Himmel kennt seine Zeiten; Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Frist ihrer Rückkehr ein; mein Volk aber kennt nicht die Rechtsordnung des Herrn.“ Diese Stelle interessiert nicht nur die theologische, sondern auch die ornithologische Zunft. Schließlich weist diese Bibelstelle darauf hin, dass man im Vorderen Orient zur Zeit des Alten Testaments (hier: um 600 v. Chr.) den Vogelzug bewusst wahrnahm, über den in Europa lange Zeit Unklarheit herrschte und erst im 19. Jahrhundert fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse vorlagen.
Ein neuer Blick?
Vielleicht regen diese beispielhaften Ausführungen über einzelne Tiere im religiösen Kontext eine spezielle Wahrnehmung an. Wer also im Urlaub einen Pelikan, im Garten einen Stieglitz oder beim Waldspaziergang ein Rotkehlchen erblickt, kann diesen Anblick ja für einen kurzen Augenblick des Innehaltens und Nachdenkens nutzen