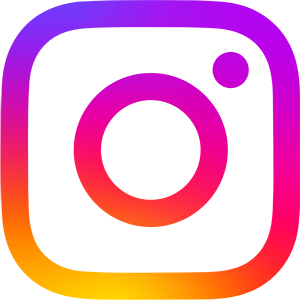Erik Potthoff
„Die Leere ist kein Mangel“
Wenige Schritte vom Digitalen Bücherregal entfernt, zwischen dem Familienzentrum St. Anna und der Pfarrkirche St. Viktor, liegt das archäologische Bodenfenster „Keller Pins“. Erik Potthoff würdigte diesen besonderen Dülmener Gedenkort in einer Ansprache am 7. Juni 2024
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Geben wir hier in Dülmen eigentlich dem „Nichts“ einen Raum – zu viel Raum? Hypen wir einen leeren Kellerraum – oder besser gesagt: einen kleinen Teil eines leeren Kellerraums?
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der Betrachtung der Dülmener Geschichte – der Geschichte der jüdischen Menschen in Dülmen.
In Dülmen lebten vier Jahrhunderte lang Menschen jüdischen Glaubens, die die Stadt durch ihre Geschäfte, ihre Betriebe und ihre Teilnahme am öffentlichen Leben gefördert und mitgeprägt haben. Sie lebten als Nachbarinnen und Nachbarn zwischen uns, 400 Jahre lang.
Als am 13. April 1942 die letzten jüdischen Mitbürger, das Ehepaar Hugo und Sara Pins, geb. Meyer, zur physischen Vernichtung aus Dülmen abgeholt wurden, war alles jüdische Eigentum verkauft oder enteignet und das Hab und Gut beschlagnahmt oder zwischenzeitlich in fremde Hände gelangt. Nur wenig nahmen sie mit. Zu guter Letzt blieb nichts oder fast nichts, dass an die jüdische Gemeinde erinnerte, die vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten einmal 67 Mitglieder zählte.
Erinnerungskultur nach 1945
Und als die Terrorherrschaft vorbei, der Krieg beendet und in der Stadt durch Kriegseinwirkung kein Stein mehr auf dem anderen stand, waren selbst ihre verlassenen Häuser, Geschäfte und Fabriken nicht mehr da.
Dem „Nichts“ musste, der Erinnerung willen, etwas hinzugefügt werden. Als erstes 1964 eine (Klage)Mauer. Als Opfergruppe schloss man die jüdischen Menschen in das kollektive Trauern und Gedenken im öffentlichen Raum mit ein. In Dülmen wurde 19 Jahre nach Kriegsende oder 22 Jahre nach der Deportation der letzten Dülmener Juden in den Grünanlagen vor dem Gymnasium eine Gedenkwand errichtet und eine Trauernde aufgestellt.
Es folgten Bronzetafeln mit Hinweisen auf die nicht mehr vorhandene Synagoge (1988) und den nicht mehr vorhandenen alten jüdischen Friedhof am Lüdinghauser Tor (1979).
Bis man sich der Menschen im öffentlichen Raum namentlich erinnerte und ihrer gedachte, bedurfte es weiterer Jahre. 20 Namen auf zwei Stelen rechts und links neben dem Findling mit der Bronzetafel auf dem ehemaligen alten jüdischen Friedhof (1990).
Erst durch die Verlegung von 44 Stolpersteinen zwischen 2005 und heute (der Großteil aber zwischen 2005 und 2008) wurden die letzten frei gewählten Wohnsitze und die Namen der Opfer im Straßenbild Dülmens sichtbar.
Mit den Klangbildern oder der tonalen Installation von Esther Dischereit und Dieter Kaufmann wurde der Versuch unternommen, jüdische Sprachfetzen akustisch erlebbar ins Stadtbild zu integrieren, um derer zu gedenken, die hier einst unter uns lebten.
Alles wurde künstlich in den urbanen Raum hinzugefügt, die Wand, der Findling, die Bronzetafeln, die Stelen, die Stolpersteine, die Klangbilder. Seit Jahrzehnten weisen wir darauf hin, dass nichts zu sehen ist, dass aber Vieles hier war.
Die Idee eines Bodenfensters
Mit dem archäologischen Fenster „Keller Pins“ erinnern wir also konsequent an das „Nichts“. An einen verlassenen Keller eines zerstörten Hauses einer geflüchteten Familie, die nur wegwollte, da ihre Heimat sie mit der Vernichtung bedrohte.
Gleichzeitig eröffnet der leere Kellerraum aber auch leicht übersehene und unterschätzte Werte, die die Leere mit sich bringen kann, wie Ruhe, Potential und Raum für Neues.
Sinnbildlich erkennt man dieses Potential an einer Vase. Eine Vase wird in erster Konsequenz vor allem deshalb sehr geschätzt, weil sie zunächst nichts enthält. Sie ist in ihrem Ursprungszustand leer. Diese Leere ist kein Mangel, sondern vielmehr die inhärente Eigenschaft der Vase. Die Leere ist also nicht ihr Mangel als vielmehr ihr Vorzug.
Ohne diese Leere im Inneren der Vase, wäre sie kein nutzbares Gefäß. Es ist also gerade das Fehlende, was der Vase das verleiht, was sie schließlich ist.
Diese Betrachtung, bei der der leere Raum im Zentrum steht, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die oft übersehene Bedeutung des Unsichtbaren. Die Leere regt uns an, an die zu denken, die hier einst zu Hause waren.
Verlassene Orte fangen oft den Augenblick ein und konservieren ihn zuweilen, zu dem Zeitpunkt, als man sie verließ. In Dülmen ist das häufig anders.
In Dülmen kennen wir uns schon deshalb mit der Herausforderung gut aus, etwas zu vermitteln, wo man nichts sieht, weil sich die Ausgangslage in der historischen Innenstadt nach dem 21./22. März 1945 so radikal katastrophal darstellte.
Erinnerungskultur, Geschichtsvermittlung konnte nur durch Hinzufügen erreicht werden. Der Heimatverein Dülmen, der vor wenigen Tagen auf sein 100jähriges Bestehen zurückblicken konnte, gründete sich 1950 neu und nahm sich dieser Herausforderung an.
Familie Pins
Heute erinnert gerade dieses „Nichts“ an Louis, Fanny, Jenny und Johanna Pins.
Sie haben hier einst gelebt. In dem Haus über dem Kellerfragment. Sie waren in erster Linie Nachbarn, Vereinsmitglieder, Arbeitskollegen, vielleicht auch Arbeitgeber, Dülmenerinnen und Dülmener, Deutsche und praktizierten mal mehr und mal weniger ihre jüdische Religion, in die sie hineingeboren wurden.
Erst durch die Beschäftigung mit dem Thema, welche jüdischen Spuren in Dülmen denn heute noch zu finden sind, entstand die Publikation „Im Bündel des Lebens“.
Die zufällige und glückliche Entdeckung einer Prozessakte der Zollfahndungsstelle Hamburg eröffnete uns die ganze Tragik eines Fluchtschicksals der Personen, deren Heimat sich zur lebensbedrohlichen Falle entwickelte und die - hier hinter dem Chor der St.-Viktor-Kirche - einst lebten.
Louis Pins starb im berüchtigten Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel, zwar nicht in einem Kellerverlies, aber sicherlich in einem dunklen Loch.
Über diese Fundstücke und weiterer Recherchen konnte das ganze Familienschicksal der einstigen Hausbewohner nachgezeichnet werden. All das fand Eingang in die beiden Publikationen „Sie müssen machen, dass ich wegkomme!“ und „Ein besonderer Schatz“. Die zweite richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler der Grundschule.
Die Existenz kleiner jüdischer Landgemeinden, wie etwa die in Dülmen, und deren Spuren verlieren sich immer mehr! Sie gehen in der Hektik der Gegenwart unter und werden vergessen. Insofern sollten Forschung, Geschichtsunterricht, Regionalhistorie und auch Heimatkunde alles daransetzen, diesem Vergessen entgegenzuwirken.
Indem wir gemeinsam diesen Gedenkort im Herzen der Dülmener Innenstadt geschaffen haben und in das Stadtgefüge einbinden, setzen wir ein Zeichen gegen das Vergessen. Wir sagen: Nie wieder. Nie wieder dürfen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder Überzeugung verfolgt werden. Nie wieder dürfen wir zulassen, dass das Dunkel des Fanatismus das Licht der Menschlichkeit überstrahlt.
Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, um diesen Gedenkort mit uns zu teilen. Möge er uns stets daran erinnern, dass wir Verantwortung tragen – für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.